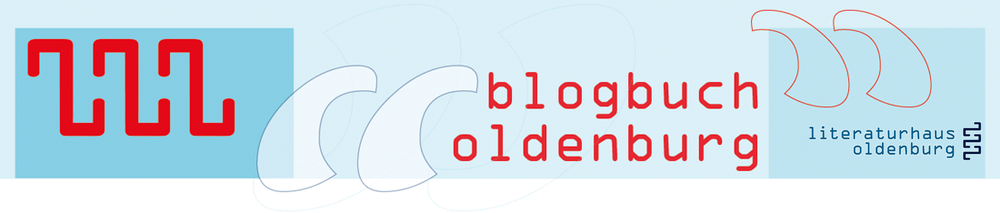Es ist noch nicht allzu lange her, da spielten das Moor und seine Gestalten den Oldenburgern einen bösen Streich.
Für gewöhnlich haben die Städter einen natürlichen Widerwillen gegen das Land, das sie umgibt. Unwägbar ist es, kaum besiedelt, und wer bei Nacht oder Nebel nicht rechtzeitig zurück in der Stadt ist, läuft Gefahr, sich auf den schmalen Moorpfaden zu verlaufen und zu versinken.
Noch dazu – so gehen die Geschichten, die in den Schenken Oldenburgs erzählt werden – wimmelt es in den Mooren, Sümpfen und Heiden von spukhaften Gestalten; Untoten, Gespenstern, Stimmen, die einen immer tiefer hinein locken, Lichter, die über dem Wasser tanzen und dem Wanderer vorgaukeln, er befände sich auf dem rechten Weg.
In der Stadt aber, so dachte man die längste Zeit, sei man vor dem Moor sicher. So dachte man auch an jenem anbrechenden Wintermorgen. Es wurde hell; genau jene diffuse Helligkeit, die ein Tag im Februar mit sich bringt. Die Nacht schien kurz gewesen zu sein; die Bürger blickten kaum auf die Uhr, zogen sich an und machten sich ans Tagewerk.
Bis die ersten Schreie durch die Straßen gellten. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Helligkeit überhaupt nicht um die Morgendämmerung, sondern um Hunderte von Irrlichtern, die sich aus dem Moor in die Stadt verirrt hatten. Manche von ihnen tanzten direkt auf dem Pflaster; andere in Schulterhöhe und wieder andere schienen von Dach zu Dach zu hüpfen.
Sie trieben so lange ihren Schabernack mit den verunsicherten Bürgern, bis es einem alten Mütterlein, das sein Auskommen mit dem Verkauf von Rübenmus bestritt, zu bunt wurde. Beherzt packte es seinen Besen und kehrte die Lichter vor das Stadttor. „Für sowas habe ich keine Zeit“, zeterte es noch, bevor es in seine Kammer verschwand.