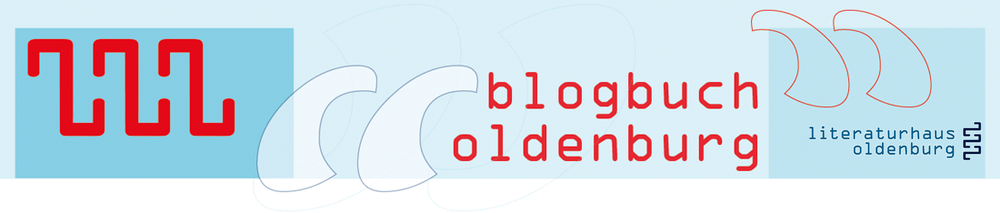Vor langer Zeit bezog ein Oldenburger Kaufmann notgedrungen Quartier in einem Andendorf. Noch immer erzählen sich seine Bewohner Geschichten über das sagenhafte Oldenburg, von dem ihnen monatelang berichtet wurde.
Ein Oldenburger also, und das mitten in Südamerika.
Nennen wir ihn etwa Enno Gödecke, lassen ihn um 1840 in Oldenburg geboren sein, Kaufmann, Kavalier und Abenteurer, der sich und seinen Textilhandel nach Lima, Peru verlegt.
Wenn es den Gödecke doch bloß gegeben hätte, jenen Schlawiner, Schlaumeier, jenen Galgenstrick und Schlot, aber wie sagt der Franzose – tant pis! Dann muss man ihn sich eben selber erfinden, sei’s drum
Der Pazifik, das ist etwas anderes als der Jadebusen!
Und die Anden, die sind etwas anderes als der Harz, soviel steht fest.
Señor Gödecke jedenfalls, kaum installiert und etabliert in der Stadt der Könige, vernimmt den Ruf der Berge und ihrer Schätze. Rasch kauft er ein paar Esel, ein Zelt, Küchenutensilien und eine rollbare Rosshaarmatratze. Mit einigen Eseltreibern macht er sich auf den Weg gen Sierra.
Unterwegs folgt er dem Ratschlag seiner compañeros und ersteht für seine indianischen Gastgeber in spe einen Sack voller Kokablätter.
Dann also das altiplano, das Hochplateau. Gödecke bedenkt den Südwinter nicht und kaum, dass er mit Mühe Huaquepata, ein entlegenes Indianerdorf erreicht, schneit es ein, und für den Gödecke geht es weder weiter noch zurück.
Glück für ihn, dass sich die Bewohner von Huaquepata durch einen wachen Verstand und regen Geschäftssinn auszeichnen. Wie sonst hätten sie es seit Jahrhunderten auf dem Hochplateau ausgehalten; Generation um Generation großgezogen, trotz aller Widrigkeiten und aller Unbill, die 4000 Meter über dem Meer mit sich bringen.
Jedenfalls – wie er da sitzt, besagter Gödecke in seinem gottverlassenen Andendorf und wie er merkt, dass ihm die Kokablätter ausgehen und die Freundlichkeit der Gastgeber im selben Maße abnimmt wie die Zahl der Blätter in seinem Beutel, da erinnert er sich plötzlich an eine seiner Kindheitslektüren: Scheherazade. Mit ihren Geschichten hielt sie den ungnädigen König immerhin tausendundeine Nacht lang bei Laune, und so denkt sich Gödecke: Was für einen König recht und billig ist, soll für die Dörfler von Huaquepata gerade gut genug sein.
Am Abend dann die fragenden Blicke und wieder die Hände, die sich fordernd in seine Richtung strecken.
Kokablätter, knarzt der Dorfälteste. Das ist die Tradition.
Aha, denkt sich Gödecke, jetzt, Gödecke! – und sagt dem werten Herrn, dass er heute Abend etwas Besseres als Kokablätter für ihn hätte. Heute Abend, sagt Gödecke, gebe es etwas, das viel stärker sei und den Geist in viel erheblicherem Maße beneble, umgarne und verwirre.
Heute Abend, so Gödecke, erzähle er eine Geschichte. Ob man an diesem Orte hier, Huaquepata, jemals von Oldenburg gehört habe? Irgendwer? Nein?
Nun gut.
Das Klima, also, halte man in Huaquepata für harsch und lebensfeindlich?
Im Vergleich zum Klima in Oldenburg sei das noch gar nichts.
Und man selber halte sich wohl für besonders zäh und ausdauernd?
Da habe man wohl noch keine Oldenburger kennengelernt.
Unsere Esel!, piepst da ein Kind aus dem Hintergrund. Unsere Esel sind die schlausten weit und breit!
Das glaube er gern, sagt Gödecke. In Oldenburg aber wären die Esel so schlau, dass es einer von ihnen sogar einmal bis zum Bürgermeister gebracht habe. Aber von Anfang an.
 Sabrina Janesch, 1985 in Gifhorn geboren, studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim und Polonistik in Krakau. Sie erhielt bereits Stipendien des LCB und des Ledig House/New York. 2009 war sie erste Stadtschreiberin von Danzig.
Sabrina Janesch, 1985 in Gifhorn geboren, studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim und Polonistik in Krakau. Sie erhielt bereits Stipendien des LCB und des Ledig House/New York. 2009 war sie erste Stadtschreiberin von Danzig.