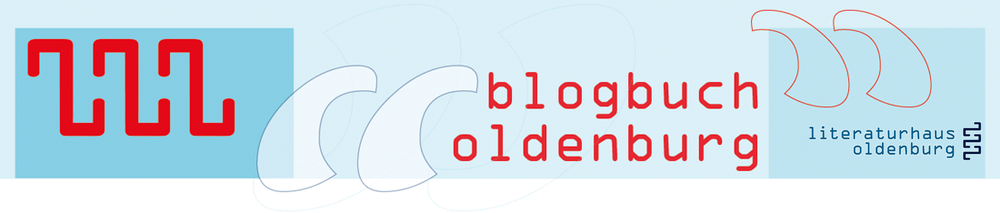Es geht mich nichts an. Es kann mir egal sein. Aber das Stechen in der Brust will etwas anderes, es sagt mir: Alles was mein Leben betrifft, geht mich etwas an und diese Frau, dieser Moment, diese Situation, dieses Projekt, das alles bin ich, sind Teile von mir, das ist mein Leben, natürlich geht es mich etwas an.Meine Finger fahren den Spalt zwischen Tür und Zarge entlang und ich möchte mit der Nase daran entlangfahren, die Luft von drüben, von drinnen, von draußen, aus Frauchens Welt riechen, atmen, in mich hineinziehen, durch den Schlitz gierig in mich hineintanken, mich vollmachen, die ganze Brust mit Frauchens Luft.
Ich kenne das Erdgeschoss, einen Teil des Kellers und die zweieinhalb Zimmer unter dem Dach, Riekes Wohnung. Zweieinhalb Stockwerke sind mir komplett unbekannt. Riesige Areale müssen das sein, ich habe keine Ahnung, was hinter diesen Türen geschieht oder wie es dort aussieht. Gruber muss hinter einer der Türen wohnen. Aber was macht Frauchen mit all dem Raum? Die Türen sind mit einem Code gesichert, mir unzugänglich.
Die Kreditkarte in Frauchens Türspalt, mit Schweiß auf der Stirn, merke ich, dass man diese Tür nicht einfach so aufkriegt. Irgendeine Art Spezialschloss und die Tür, schwer und massiv, bewegt sich nicht, auch wenn ich mich dagegen werfe. Der Rahmen aus weiß lackiertem Stahl. Rechts an der Wand ist ein Ziffernblock zur Eingabe eines Codes. Dann eben nicht, denke ich und will gehen und dann denke ich, ich muss nur lauschen, ich muss nur mir selbst zuhören, muss es nur suchen gehen. Muss tiefer in mich hinabsteigen und dort irgendwo werde ich die Antwort finden. Und ich denke an Frauchen, an ihre dünnen Marathonbeine, an ihr Gleiten im Raum, an Frauchen in vollendeter Zeitlupe und ich sehe mich selbst im Flug, ich sehe meine Hände und wie sie eine elegante Choreographie tanzen. Ein Finger hüpft jetzt von Zahl zu Zahl, die Tasten geben nach unter dem sanften Druck meiner tanzenden Hand. Da plötzlich summt es und klackt und dann springt die Tür auf, öffnet sich einen fingerbreiten Spalt. Ich bin zurück im Hier, drücke sie auf, gehe hinein. Es zieht mich in den sich öffnenden Raum, auf einen glatten Steinflur. Ich laufe durch Gänge, Schläuche, Räume. So viel Platz. Große, leere Flächen, wunderschön gestaltet, minimalistisch bestückt, offene, großzügige Räume, viel Naturstein und altes Holz. Wendeltreppen und viele Fenster. Aber wie unbewohnt. Ich laufe durch diese Räume und wo ich eine Schublade sehe, ziehe ich sie auf, ich sehe mich um, so gut es geht. Aber alles ist leer. Die ganze Aufregung umsonst, aber mein Herz hört nicht auf, hämmert fest im Hals, prügelt auf mich ein.
Dann ein kleiner Raum mit einer Matratze. Ein Kleiderschrank, ein Spiegel, ein Waschbecken, und ein Klo. Private Gegenstände. Dinge, die vielleicht Frauchen gehören, eine kleine mickrige Pflanze, trist und langweilig, unkrautartige lange, kahle Stiele, ein Schwamm, eine Bürste, Handcreme, ein paar Zeitschriften (Psychologie Heute, Gala, Brand Eins), ein Bikini, eine Brille und ein Block mit einfachen, aber durchaus gekonnten Bleistiftskizzen. Auf einer bin ich zu sehen. Oder? Dieses Männchen müsste ich sein und um mich herum die Tiere, das könnte passen. Ein Gesicht habe ich nicht, aber das bin ich. Ich reiße es aus dem Block und stecke es ein. Alles, was mein Leben betrifft, geht mich natürlich etwas an. Ich hebe das Bikinihöschen auf und rieche daran. Getragen. Ein sanfter, süßer Geruch, ein bisschen Chlor. Ich lecke und schmecke nichts, nur das merkwürdige Polyesterkitzeln auf der Zungenspitze und dann stopfe ich mir das ganze Höschen in den Mund, ich esse es, kaue und kurz bevor ich schlucke, spucke ich es doch wieder aus, mir vor die Füße. Hab ich dich, Frauchen. Drei Paar Schuhe stehen an der Wand. Ich rieche am Kopfkissen. Lavendel und Haar. Zu groß für mein Maul, ich würde es fressen.
Am Ende des Flurs eine Flügeltür, dahinter – ich muss die Augen zusammenkneifen – sind weiße Wände, weiße Dielen, ein beißendes, augenbetäubendes Weiß. Weiße Säulen vor der Fensterfront. Vier Stück. Man geht sicher acht, neun Schritte von einer bis zur nächsten Säule, dieser Raum ist so groß wie meine Werkstatt. Frauchens Atelier. So viel Licht knallt durch die riesige Fensterfront, dass einem schwindelig wird. Leinwände, Staffeleien, Farben, Pinsel, Spachtel stechen scharfkantig aus dem brennenden weißen Hintergrund. Sie malt also. Ein Königreich für eine Sonnenbrille. Verstärken die Fenster das Licht? Gibt es das? Lichtverstärkendes Glas? Wenn es das gibt, hat Frauchen es mit Sicherheit. An eine der Wände sind Fotos gepinnt. Zeitungsartikel, Buchseiten, aus Magazinen ausgerissene Bilder. Dieser Raum ist das einzige Element von Chaos in dieser irritierend streng geordneten Wohnung. Zusammen mit den Gläsern, in denen die benutzten Pinsel in einer Lösung stehen und aussehen wie Blumensträuße ohne Blüten oder wie im letzten Moment gehaltene Mikadostäbchen. Ein paar Farbkleckse auf dem weißen Boden. Ansonsten: eine mathematisch wirkende Ordentlichkeit. Kontrollierte Leere. Lichtnahrung?
Das Bild auf der Staffelei ist mit einem Stück Stoff abgehängt. Ich sehe aus dem Fenster. Sie sieht genau auf meinen Schuppen, auch wenn sie nicht hineinsehen kann. Aber sicher hat sie Kameras installiert und die Bilder werden direkt auf ihr Tablet übertragen.
Ich sehe in den gelben Kühlschrank, der selbstbewusst im Raum steht: Teures Wasser in schweren Glasflaschen. Ich nehme eine Flasche und trinke und das Wasser geht nur so in mich hinein, es läuft einfach, und es schmeckt, denke ich, es schmeckt, dieses Wasser ist so unendlich mild, es ist als streichelte es Mund und Hals ganz sanft von innen, Schluck für Schluck. Das ist gutes Wasser, Frauchens Wasser, natürlich. Wahrscheinlich irgendein Yoga-Wasser aus dem Himalaja. Ich trinke und trinke die ganze Flasche aus und ich nehme noch eine zweite und auch die gleitet einfach in mich hinein, ohne dass ich ein einziges Mal absetze, einfach rein, kein Verschlucken, kein Aufstoßen. Und langsam haben sich meine Augen an die Helligkeit gewöhnt. Mit Pupillen klein wie Kugelschreiberspitzen gehe ich auf ihre Staffelei zu und greife nach dem Stoff, kurz halte ich inne, ich weiß nicht wieso, und dann ziehe ich den Vorhang auf:
Ich sehe einen Mauerspatzen, sehr nah, sehr groß, riesig, von vorn, hinter ihm mehr Mauerspatzen, ein Schwarm, sie stehen in der Luft wie gefroren, wie im Flug gestoppt, in einer seltenen Bewegung für immer festgehalten: dem Moment des Entschlusses zur Flucht. Und ganz hinten im Bild, kaum zu sehen, im dunklen Hintergrund, oben auf der Treppe: Beine von Menschen. Plastinierten Menschen. Ich laufe an der riesigen Leinwand entlang, sehe mir alles ganz genau an, ich atme die Farbpigmente, immer wieder stoße ich mit meiner Nase gegen dieses fein ausgearbeitete Bild, ich fasse es nicht und nicht zu fassen ist auch, wie hyperrealistisch es aussieht, es ist als beträte man einen Raum der wirklicher ist als die Wirklichkeit, eine Welt, genauer als alles Bekannte. Ich
muss mich setzen. Hinlegen. Wie kann sowas sein? Kann es das wirklich geben? Habe ich Angst? Ich zittere. Ob Glück oder Angst oder Ahnung oder Licht oder Kunst. Etwas geschieht. Ich habe nie so viel gefühlt wie seit Frauchen, denke ich, starre in ihr beißendes Deckenweiß und versuche, mich irgendwo zu halten, irgendeinen Halt zu finden, nicht abzudriften. Ich weiß, ich muss mich erheben, ich muss raus. Ich habe hier nichts zu suchen, ich muss den Vorsprung retten, den minimalen, hauchdünnen Vorsprung, dass ich weiß, dass sie weiß, wenn sie das nicht auch längst weiß, schon vorher wusste- es wäre ein unmögliches Glück, Frauchen endlich einen Schritt voraus zu sein. Aber ich kann nur liegen und Zweifel sein:
Wie kann das sein, dass einer davon weiß in der Welt? Das kann nur ich gesehen haben. Ich habe nie jemandem ein Sterbenswörtchen davon gesagt. Wie kann das jemand wissen? Kann etwa ein anderer dasselbe sehen, aus einer minimal anderen Perspektive? Was ist das dann, was wir da sehen? Was soll das? (
Oder hat sie mir auf irgendeine Art Gedanken in den Kopf getan? Gepflanzt? Wie ein Kind in den Bauch? Hat sie mein Hirn besiedelt, benutzt, hat sie – kann das einer können? Etwas in den Kopf eines anderen tun und es wachsen lassen, es immer wieder füttern und nähren und dieser andere merkt nicht, dass in ihm fremde Gedanken gedeihen, und sie für die Eigenen hält. Aber wie nur? Wie? Handauflegen? Können diese kleinen Schildkrötenhände Gedanken senden, Gedankenkeimlinge, Gedankensamen? Wie lange sind meine Gedanken schon meine Gedanken? Wie lange gehören meine Träume schon nicht mehr mir selbst? Wie lange schon, bin ich vielleicht nicht mehr als ein Brutkasten für dieses merkwürdige kleine Hirn?
Ich sehe mich um. Links und rechts der Staffelei stehen weiter Leinwände, ebenfalls mit weißem Stoff bedeckt. Ich sehe sie mir an, ziehe nach und nach die Stoffe herunter. Ich sehe: Nahaufnahmen des menschlichen Körpers, Ansichten wie aus einem Biologiebuch, Aufbau der Knochen, der Muskeln, des Nervensystems, enthäutete Menschen, Totalen, Nahaufnahmen, Makros. Studien.
Ich stolpere einige Schritte, bis ich mich fangen kann. Ich breite die Arme aus, versuche meine alte Mitte zu finden, einfach nur zu stehen, gerade, ohne zu wanken. Ich sammele mich langsam und wanke dann Richtung Tür. Auf der anderen Seite der Flügeltür stehe ich dann eine ganze Weile, die Klinke noch in der Hand, wie um mich zu vergewissern, dass ich die Tür auch wirklich geschlossen habe.
“Komm”, sagt jemand. Ich fahre zusammen. Drehe mich um, sehe auf, sehe: Rieke.
“Ich bin nur deinetwegen hier her gekommen. Nur, damit du nicht verloren gehst. Ich will, dass wir jetzt gehen.”
“Rieke!”
“Bitte.”
“Rieke, oh mein Gott, ich …
„Los, jetzt!“
„Rieke, so einfach ist das nicht.“
„Doch, genau so einfach ist das. Jetzt und los.“
„Ich… ich bin noch nicht fertig mit dieser Sache hier. Weißt du, ich. Sie.“ Ich fuchtele mit meinen Armen um meinen Kopf, als könnte ich so etwas von dem erklären, was hier geschehen ist, geschieht, geschehen kann, wird. Ich schüttele den Kopf, weil Worte fehlen, Gesten, weil manche Dinge nicht aussprechbar sind.
“Du wirst nie fertig damit.”
“Rieke, bitte, das verstehst du nicht. Das ist die Chance meines Lebens… Ich… ich fange gerade erst an zu verstehen, was hier …”
“Loris, wir müssen weg von hier. Das ist nicht gut für uns.”
“Rieke …”
“Für unser Kind…”
(unser Kind?)