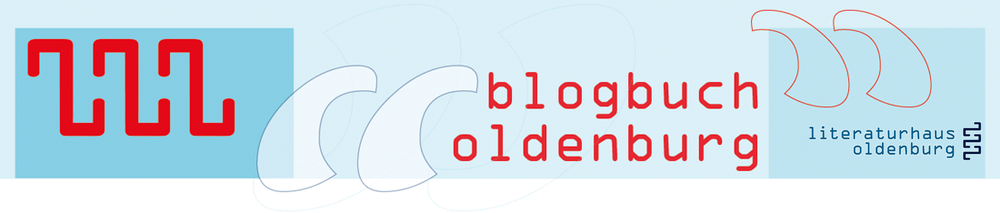„Nichts in diesem Lande ist aufgeregt, seine Glieder zucken nicht konvulsivisch, es trägt keine tollen Hirngespinste im Kopfe, und doch ist’s in diesem sehr lustig, hell und sinnig. Wohl selten findet man einen so praktisch vernünftigen, so ruhig denkenden und doch so gemütlich warm fühlenden Menschenschlag wie diese Oldenburger.
Es sind nordische Naturen an Ruhe, Besonnenheit, Biederkeit, südliche an Herz und Gemüth. Schwerlich wird jemand auch nach kürzestem Aufenthalte das Land verlassen können, ohne den Bewohnern gut zu sein. Es ist hier, was schlichte, offene, redliche Charaktere betrifft, das Deutschthum in wahrhaft schöner Blüthe zu finden.
Der helle, freie Gedanke, welchem man überall begegnet, thut nicht minder wohl. Diese Intelligenz ist durchaus naturwüchsig, nicht geziert, gemacht, nicht treibhausartig, auch nicht mit so vielen, herben, ätzenden Bestandtheilen des Ironischen versetzt, wie z. B. die Berliner.“
So schreibt Joseph Mendelssohn in „Eine Ecke Deutschlands“, erschienen 1845 in Oldenburg, Verlag Gerhard Stalling.