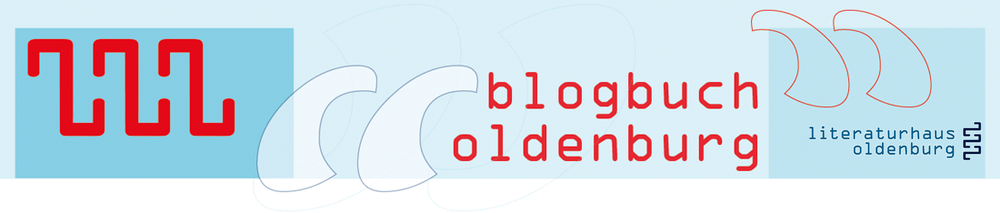Aber nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck von den Oldenburgern entsteht; etwa, dass sie vom äußerst zurückhaltenden, reservierten, gar kühlen oder abweisenden Schlage wären. Solches mag vielleicht für die Bewohner anderer Städte – ja: aller? – rundherum gelten, insbesondere, aber nicht nur Hamburg, Bremen und Hannover, nicht aber für die Oldenburger!
Die Oldenburger nämlich, trotz aller widrigen Umstände, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen – sagen wir vereinfachend, Wetter, Boden, Sprache, Küche, Gesamtsituation – die Oldenburger also zeichnen sich durch ein Temperament aus, das man bezeichnen muss als feurig, hitzig, inbrünstig und ungestüm im Allgemeinen.
In Oldenburg wurde quasi die Leidenschaft erfunden, und das kam so. Oldenburg war lange Zeit eine Stadt aus Holz, und ihr Fachwerk war der Stolz der Bürger. Nirgends rühmte man sich mehr der Schönheit und Raffinesse der Fassaden.
Schließlich passierte das Undenkbare: Ein großer Brand zerstörte die Stadt und all ihre Holzbauten. Oldenburg war am Boden. Und erhob sich aus seiner Asche. Aus einer Stadt aus Holz wurde eine Stadt aus Stein. Die neuen Häuser bestanden fürderhin aus Ziegeln, die eigens für diesen Zweck in riesigen Öfen gebrannt wurden.
Was kaum einer vorher sah: Die Feuerhitze der Steine bewirkte eine wundersame Wandlung der Bewohner. Wo vorher vornehm gewispert wurde, wurde nun herzhaft gepoltert, wo zuvor spitzmündig der Friesentee gesückelt wurde, wurde nun geschmatzt und gesprotzt; wo vorher Hände geschüttelt wurden, wurde nun geküsst, umarmt, auf Schultern geklopft und generelle Freude am Menschsein gepflegt.
Strahlung, räsonierte man später, habe aus den Oldenburgern das gemacht, was sie heute seien.