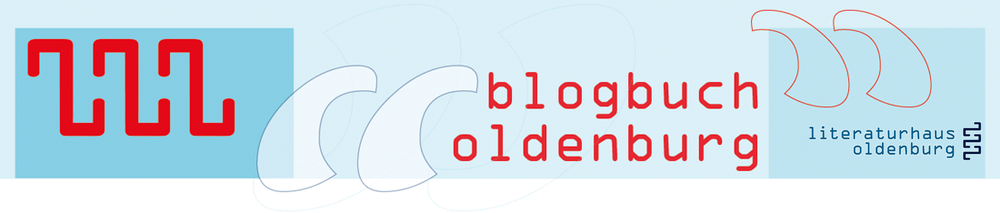Oldenburg ist ein gemeingefährlicher Ort, den man, wenn man an seinem Leben hängt, besser meiden sollte. Wenigstens bei Regen.
Nicht genug, dass Oldenburg sich auf der Nordhalbkugel befindet, und somit alle Jahreszeiten genau falsch herum statt finden; abgesehen davon wechselt das Wetter alle halbe Stunde und hält die Oldenburger zum Narren. Die meisten von ihnen trauen sich nur noch mit großen Koffern oder Seesäcken auf die Straße, in denen sie Kleidung für alle Eventualitäten mit sich führen. Mit der Zeit sind besonders praktisch veranlagte Gemüter dazu übergegangen, sich an strategisch günstigen Straßenkreuzungen und Plätzen kleine Erdhöhlen zu graben, in denen sie ihre Ausrüstung verstauen.
Die Praktik kam schnell in Mode, so dass der Grund und Boden von Oldenburg durchsetzt und gespickt ist mit Sommerhüten, Regenschirmen, Wintermänteln, Schneeschuhen und Badeanzügen. Mit der Zeit aber vergaßen oder verwechselten die Bürger ihre Erdhöhlen; sie suchten sie vergeblich oder gruben sich neue. Die Oldenburger mögen sich vielleicht durch einzigartige Intelligenz auszeichnen; Nebensächlichkeiten aber entziehen sich ihnen bisweilen.
Zieht eine der gefürchteten Regenfronten über das Land und entlädt seine Wassermassen auf die Stadt, so verwandelt sich der gesamte städtische Untergrund in ein instabiles, trügerisches Gelände. So mancher Fremde, gerade in der Stadt angekommen, fand sich in einem der Erdlöcher wieder, zusammen mit klammer Winter- und Sommerausrüstung.
Die erbosten Reisenden haben diesem Phänomen den treffenden Namen Oldenlöcher gegeben; und ein Schelm, wer behauptet, jener Begriff hätte sich mit der Zeit auch für die Oldenburger an sich durchgesetzt.