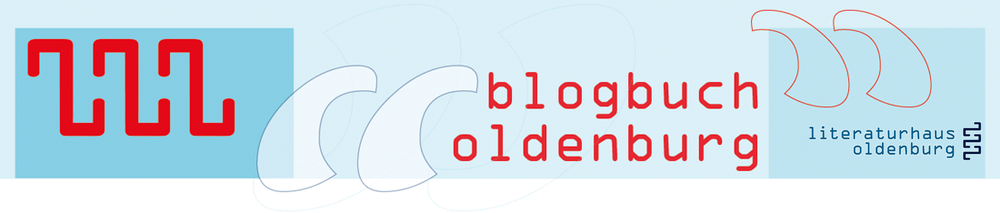Nun wird es kaum verwundern zu hören, dass jene geographischen und geologischen Eigenheiten – extreme Tiefenlage, Strahlung der Backsteine, darüber hinaus aber auch Dämpfe aus dem Moor und merkwürdig schillernde Herbstnebel – dass all jene Eigenheiten also zu einem ausgeprägten Scharfsinn der Oldenburger führten. (Die Pfeffersuppe mag das ihrige beigesteuert haben.)
Von allen klugen Oberhäuptern war aber Anton der klügste, und so ist er als Großer Häuptling Anton in die Annalen der Stadtgeschichte eingegangen.
Schon als junger Mensch ahnte Anton, dass Leben außerhalb Oldenburgs möglich und also wahrscheinlich sein musste; und um sein Wissen über die Welt und ihre Erscheinungen zu mehren, ließ er sich von seinen Handwerkern eine Kutsche anfertigen, mit der ihn seine geliebten Pferde in die entlegensten Königreiche und Grafschaften bringen konnten.
Über jene Kutsche wurde seinerzeit in Oldenburg viel Aufhebens gemacht. Angeblich fuhr sie so schnell, als ob hundert Pferde sie zögen; wie auf planen Bahnen gleite sie über das Land und führe den Großen Häuptling in einem Bruchteil der üblichen Reisezeit an sein Ziel.
Das ist schwarze Magie, brummten die Alten. Das ist die Zukunft, flüsterten die Jungen.