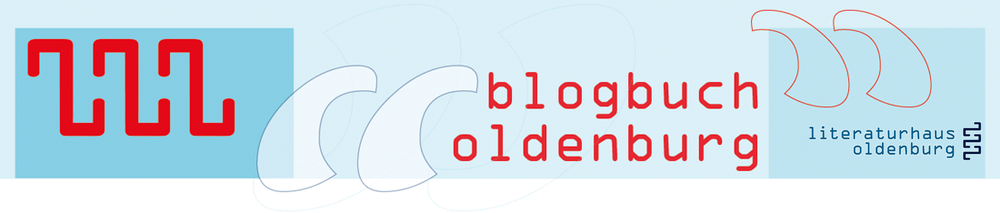Hohe Berge schön und gut. Sicher, man muss sich an Kälte, Hitze, Höhe, Wind, Lebensmittelmangel und Kargheit gewöhnen.
Aber immerhin, und das gilt selbst für die Anden, immerhin sind sie immerfort da, Tag und Nacht. Selbst wenn man scherzeshalber in der Nacht aufsteht, um rasch zu kontrollieren, selbst dann liegen die Berge im schönsten Sternenglanze da und haben sich um keinen Zentimeter bewegt.
Auf diese – Pardon – Klötze ist Verlass. Da bedarf es keiner schwierigen Berechnung oder Kalkulation. Ein Berg ist ein Berg. Das kann man sich einmal merken und nie wieder darüber nachdenken.
Nichts dergleichen lässt sich vom Meer behaupten, in dessen Nähe Oldenburg liegt: Eine quecksilbrige Fläche, grau und unbewegt – so scheint es zumindest.
In Wirklichkeit ist es mal da, mal wieder nicht, und nicht einmal die größten Gelehrten der Stadt können voraussagen, wann das Wasser wieder über den Meeresboden rollen wird.
Zurückzuführen, so ist es nachzulesen in jedem besseren Werk über die allgemeine Geschichte Norddeutschlands, ist dieses Phänomen auf einen Kontrakt aus dem Jahre 1691 zwischen dem englischen König und den Königen des Festlandes. Es gab einfach nicht genug Wasser für alle. Da half nur eines: teilen.
Die Pumpen und Schleusen, die die britischen Ingenieure im Meer versenkten, waren eine Meisterleistung. Sie funktionieren bis heute, auch wenn keiner genau weiß, wie und wo.