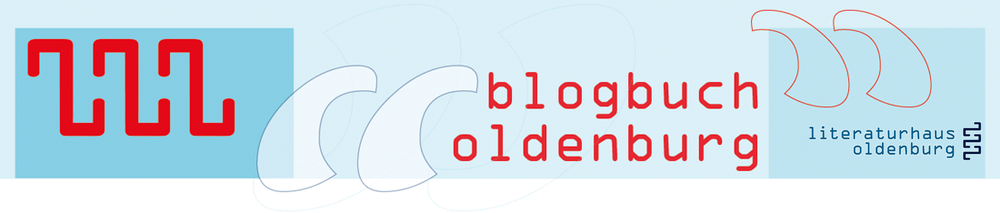Allein der erste Schnitt.
Dieses Gefühl. Ein Skalpell anzusetzen und in die tieferen Schichten vorzudringen. Das Unsichtbare freizulegen, Geheimes hervorzuholen, ins Licht zu zerren. Meine Spuren zu hinterlassen und dann wieder zu verwischen.
Es geht nicht um mich.
Und das heißt: Es geht um etwas Größeres. Und das heißt: Es gibt etwas Größeres. Weil wir es denken können. Wenn auch nur über Bande.
Schnitt.
Und wie das Fleisch ins Licht platzt, als habe es jahrelang nur auf diesen Moment gewartet, als sei es nur dafür gewachsen, ist ein ebensolcher Beweis. Schnitt, nur nach oben, um an den Knochen nichts zu beschädigen.
Ich sehe mir selbst gern zu. Wie ich schon immer Menschen gern zugesehen habe, die ihr Handwerk beherrschen. Schuster, Schneider, Zimmerleute, der Friseur um die Ecke, ja, sogar einem wirklich guten Dönerverkäufer könnte ich stundenlang zusehen, die Eleganz seiner Bewegung bewundern, optimierte, von ewiger Übung gefilterte Handgriffe, reingewaschen, freigelegt. Über die Jahre eingekerbt in den Bewegungsablauf, wie das Leben einen eben zurechtschleift.
Ich bin froh, dass die Natur die Augen nicht in den Händen untergebracht hat, ich könnte meine eigenen sonst nicht sehen – Hände, die kunstvoll das Fleisch anheben, ziehen, spreizen, schneiden.
Meine Hände, die all das tun. Elegant und sicher, gezielt und mit beeindruckender Geschwindigkeit gleiten sie über Aufsichtsrats kalte, feste, rote Muskeln. Nichts davon muss mehr gedacht werden. Die Hände handeln frei, sie folgen einer Logik, die mechanisch ist und gar nicht bis in den Kopf vordringt, die Hände agieren selbständig, als hätten sie ein eigenes Hirn, als seien sie ein geschlossener Kreislauf.
Dann liegt er frei. Rot und wund, glühend, wie ein Monate zu früh geholter Embryo, unfertig für die Welt. Schutzlos überreizt. Immer muss ich schmunzeln beim Anblick eines enthäuteten Leibs. Jedes noch so große, mächtige Tier ist ohne Haut nur ein zum Nacktmull geschrumpfter Witz.
Mit einer Art Schraubenzieher, Stocher, sagt man, hebelst dut man die Augen aus dem Schädel und kappt dann den Sehnerv in der Vertiefung. Die Lichter, sagt man. Und den Lecker, schneidet man als nächstes raus, an den Innenseiten der Unterkiefer entlang. Dann zieht man ihn von vorn nach hinten mit der Schlundöffnung weg und schneidet die Zungenbeine raus. Unterhalb des Hinterhauptloches. Dann kommen die Kaumuskeln und Sehnen raus. Innen und außen am Knochen entlang. Alles weg. Dann den Unterkiefer aus den Oberkiefergelenken hebeln. Ein fester Ruck nach hinten. Den Schädel grob entfleischen. Dann mit einem Stocher das Gehirn kleinstochern. Schale mit dem Gartenschlauch ausspülen.
Erst riecht es wie an der Fleischtheke, nur intensiver, nach kaltem Fleisch.
Dann schneidet man hinein und schon riecht es anders, in Bauchraum und Brust. Es riecht nach Blut vielleicht und etwas Verborgenem, etwas, das nicht für das Licht gemacht ist. Erdig, schwer und ernst. Moos und Metall. Es riecht ein bisschen nach Hinterhof und Regen auf sonnenwarmem Stein. Jedes Tier riecht anders, drinnen, aber eins haben sie gemeinsam: einfache, erdige Gerüche. Bevor sie anfangen zu faulen, und wenn der Darm unbeschädigt bleibt.
Ich lasse Wasser in eine Plastikwanne und lege die entfleischten Knochen hinein.
Wenn man stirbt, hält die Zeit an. So ungefähr stelle ich es mir vor:
Die Zeit gesprengt, was bleibt ist eine Landschaft aus dem, was man geliebt, gehasst, gewollt, ertragen und geträumt hat. Was man verstanden, nie begriffen, gewusst und gemacht hat. Was man gesehen, geschmeckt und gespürt hat.
Und diesen Moment versuche ich zu treffen, wenn ich präpariere. Auch Tiere haben ein Immer und ein Ewig und ein Nichts. Haben Freunde und Feinde. Angst und Geborgenheit. Ich kenne sie ja besser als jeder andere. Dafür bin ich hier, denke ich und fühle meinen Puls im Hals, ein vibrierendes Zucken hinter den Rippen. So viel Leben wie sonst nie. Das ist der Zusammenhang. Ich habe es gefunden, mich gefunden, in diesem Tun. Die Tiere von innen her zu begreifen. Ihr Wesen auszustellen, zu erhalten, den Menschen zu zeigen, begreiflich zu machen. Meinen Beitrag zu leisten, zur Enträtselung der Welt, des Lebens, unserer Rolle im Universum. Ja! Superlativ! Höchststufe! Das wäre der Sinn des Ganzen, ein Ziel, mein Ziel. Ein Museum zu schaffen, nein, vielmehr einen Tempel, ein Wunder. Keinen Raum mit verstaubten, ausgestopften Tieren, sondern einen Ort, den Ort, der das Leben verlängert, unendlich verlängert, ins aufgelöste Immer vergrößert und spiegelt. Den Tod hingegen ins Leben rückverlagert, überhaupt erst fassbar macht und nicht mit klugen Worten hantiert und damit alles nur winzig und eindimensional menschlich macht. Ein Ort, der die Sprache des Lebens spricht, der die Bilder kennt, aus denen das Leben besteht, die Träume, Ängste und den Tod. Diesen Ort zu bauen, in die Welt zu stellen, aus ihr herauszuschälen, aus mir hervorzuholen, das wäre es. Einen Ort, in den man hineingeht und den man nie wieder verlässt, selbst wenn man ihn verlässt, der sich in einen hineinschraubt, eingräbt, umgräbt, umprogrammiert, der den Tod endlich in das Leben integriert. Ein Ort für Verrückte, für Wilde, für Suchende, ein Ort, anders als alle Orte, ein Ort, der Schnittstelle ist für das Bewusstsein, ein Raum aus mir, Grenzlinie zwischen Leben und Tod, nichts und allem. Das ist, begreife ich nun, da es so nah liegt, wie noch nie, endlich greifbar, machbar. Das ist vielleicht das Einzige, was ich dieser Welt wirklich zu geben hätte.
Ich war ein Leben lang nur Parasit, eine Zecke in einer Hautfalte der Welt, plötzlich hätte so alles einen großen, monströsen, gigantischen, nachträglichen Zweck. Ich musste mich vollsaugen, musste meinen Hass, meinen Ekel, alles, was ich eben in mir trug in den Kreislauf der Welt pumpen, weil ich an sie angeschlossen war, ich nahm auf, ich gab ab und nun, genährt, gestärkt, kann die Zecke, abspringen und aktiv werden, ein Schöpfer, ein Medium, ein Gesandter. Denn das bin ich. Weder die Maya-Tempel und Pyramiden, noch die Kirchen und Klöster, die heiligen Schriften und Atommodelle und vermeintlichen großen Künstler mit all ihren Gemälden, Skulpturen, Schriften, Fotos und Filmen, haben den Tod so begriffen und gemalt wie ich. Nichts und niemand. Es pumpt in mir wie sonst nur nach einem Sprung in Lohmanns Planschbecken. Es ist, als träfe mich ein Strahl, als sei ich ein Glas und jemand gösse von oben endlich eine lang ersehnte Flüssigkeit in mich, führe mich endlich meiner Bestimmung zu. Wie lange war ich ein merkwürdiges Etwas aus Glas, leer und ohne Sinn und Zweck, für irgendwas bestimmt, ohne es selbst zu ahnen, und als es plötzlich in mich hineinfloss war klar, dass ich schon immer war, was ich jetzt werde und alles gut ist und einem Sinn folgt. Ich bin ein Glas. Ich bin ein Tempelbauer. Ich bin der Mensch, der den Menschen den Tod bringt.
Oh, es weckt mich!
Hier! will ich schreien, hier bin ich!