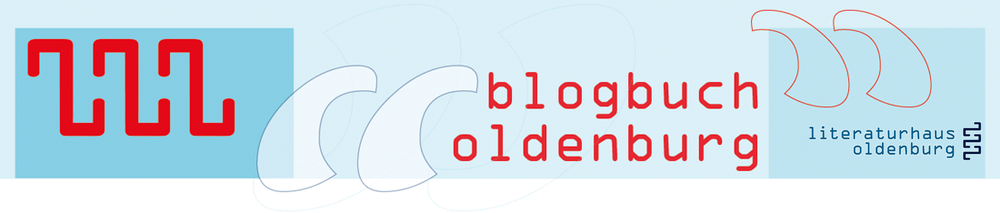So vergingen die Tage. Eine ganze große Weile. Ich habe nichts davon gezählt, weil es um Zählen plötzlich nicht mehr ging. Es ging darum, zu verstehen, anzukommen, zu atmen, mich zu reinigen. Ich schlief bei Müdigkeit am Ufer meines kleinen Sees, ich aß bei Hunger, was ich eben fand, Insekten, Moos und Beeren, ich rannte, wenn die Beine wollten, wie ein Kind durch das Gestrüpp, ich sang, wenn etwas in mir wollte, laut wie ein Vogel am Morgen, ich turnte, lachte, schwieg und dachte nach. Ich war frei. Und fast vergaß ich, warum ich an diesem See saß und wartete. Das waren die Tage. Ich spürte. Mich. Hier. Unglaublich. Eine ganz große Anwesenheit. Und da sitze ich an diesem See, auf einem Grün, unter einem Blau, in einem Zwitschern und Rascheln und Gluckern und einem ganz leichten Wind. Und ich strecke mich aus, so voll von mir selbst, endlich, lege mich lang und flach in diese satte glückliche Welt, breite mich aus, fühle die warmen Strahlen auf meinem Leib, schließe die Augen.
Und als ich erwache, die Augen aufschlage und in die Dämmerung sehe, höre ich das Knistern eines kleinen Feuers, nur einige Meter entfernt, ich drehe den Kopf: da hockt ein Mann. Ich setze mich auf. Blicke über die breiten Schultern des Mannes auf den spiegelglatten See, es ist ein Gemälde aus Wasser und Schilf und unendlicher Ruhe. Mann vor Seelandschaft, eine Meditation. Da sagt der Mann, ohne sich umzudrehen: „Da ist Tee auf dem Feuer, nimm dir.“ Und ich nehme mir, verbrenne mir die Finger an dem heißen Topf, aber ich umarme den Schmerz wie einen alten Freund, denn dieser Schmerz, das bin ja ich. Ich gieße die dampfende Flüssigkeit in den Becher, der schon bereit steht und nippe vorsichtig an dem klaren, duftenden, heißen Tee. Zwei Männer schlürfen Tee vor Seelandschaft. Ich hocke mich zu dem Mann. Ein Gemälde. Blicke ihn von der Seite an, Umriss vor Waldlandschaft. Schilfrascheln, eine Entenfamilie rückt aus.
„Schön, dass du da bist“, raunt der Mann, der mein Onkel sein muss, und schlürft Tee, dreht dann langsam den Kopf und sieht mich an mit seinem braunen, zugewucherten Kopf. Sein Mund weitet sich horizontal, gibt ein erstaunliches Weiß frei und formt sich dann in einer mir bekannten, fließenden Bewegung zu einem kleinen Kreis. Der Mann breitet die Arme aus. „Endlich“, schnurrt er und auch ich breite ganz selbstverständlich meine Arme aus, ohne darüber nachzudenken, und wir finden ineinander. „Endlich“, schnurrt der Mann und ich schließe die Augen, lasse mich fallen, werde umarmt wie von einem alten Freund, denke: endlich!Ich rieche den Mann, Talg und Schweiß, Zwiebel, Knoblauch, Kräuter, Schlaf und Mist, man würde sagen, dieser Mann stinkt, aber das stimmt ja gar nicht, er riecht nach dem, was er ist. Ich umarme diese Gerüche wie … und da springt der Mann plötzlich auf, läuft zum Feuer, rafft eilig ein paar Sachen zusammen und steht leuchtend und lächelnd zwischen Feuer und See vor mir und sagt: „Komm!“
Der Mann, der mein Onkel sein muss, ist ein großer, kräftiger Umriss, der vor mir durch den Wald taucht. Man würde denken, so ein Mann hätte etwas Schwerfälliges, laut Rumpelndes an sich, aber nein, er tänzelt beinahe, hüpft und duckt und springt von einem Bein auf das andere, er joggt und läuft und sieht sich dann und wann nach mir um, ich muss zusehen, dass ich hinterher komme. Meine Lunge brennt, ich lächele und er hält mir immer wieder Sträucher und Äste aus dem Weg. Dieser Mann, vielleicht knapp zwei Meter groß, geschätzte hundertfünfzig Kilo schwer, er fliegt über den weichen, weichen Waldboden. Hier und da hält er an, deutet freundlich mit der Hand auf eine Ringelnatter oder einen Vogel im Wipfel eines Baumes. Er zupft ein Blatt von einem Strauch oder einer kleinen Pflanze, zerreibt es zwischen den schwieligen Fingern seiner dicken Pranken, riecht und schließt die Augen, hält auch mir die betörend aromatisch riechenden Finger unter die Nase. Plötzlich hält er mitten in der Bewegung inne, ich habe mich so sehr an sein Tempo gewöhnt, dass ich beinahe in ihn hineinrenne, und er legt den Kopf schräg, lauscht in den Himmel, legt den Zeigefinger auf seine Lippen. Ich wage nicht, zu atmen. Dann formt er seine Hände vor dem Mund zu einem Trichter und dieser Berg von Mann, dieser Bulle aus Fleisch und Haar und Dreck, er singt ein Lied mit der Stimme eines Vogels, den ich mir nur klein und gelb und aufgeregt denken kann. Und tatsächlich antwortet von irgendwo oben, scheinbar eine ganze Kolonie von Vögeln. Und da lacht der Mann und schlägt sich auf den Schenkel. „Sind sie nicht komisch?“, flüstert er, dreht sich um und joggt weiter.
„Ich kann nicht mehr“, ächze ich irgendwann und der dicke, große Mann sieht mich erstaunt an. Er geht leicht in die Knie, bietet mir den Rücken an und seine Arme. Ich muss nur aufsteigen. „Ist nicht mehr weit“, sagt er und ich springe auf, hänge auf seinem Rücken wie ein Affenkleines, huckepack, und dann geht es im Galopp weiter. Ich werde getragen, lasse gehen, lasse fallen und irgendwann werden die Bewegungen langsamer, ruhiger, höre ich das Schnauben meines Onkels und sein Flüstern: „Da! Siehst du? Da sind sie.“ Vorsichtig und langsam öffne ich meine Augen, ein grüngefiltertes Weiß blendet mich und meine Pupillen brauchen einige Momente, bis ich erkennen kann, auf was die dunkle, behaarte Hand des Mannes deutet: Kühe, drei Kühe, schöne, glatte, ruhige schwarze Leiber, prächtig und elegant, stehen sie zwischen alten, hohen Buchen und kauen gelassen, ihre Schwänze schlagen in einem gleichmäßigen Takt um ihre Hinterteile, ihre faustgroßen, warmen Augen blicken entspannt in unsere Richtung. „Olga“, sagt er und deutet auf die Kuh ganz links, dann weiter: „Moni, Heide.“ Er setzt mich ab und dreht den Kopf zu mir, ein endlos zufriedenes Lächeln im Gesicht, er sieht aus wie eine Mischung aus Bär und Buddha. „Du musst sie riechen, streicheln“, dann geht er vor und ich folge ihm vorsichtig. Mein Onkel stellt mich seinen Kühen vor. Ich halte ihnen meine winzig wirkende Hand vor ihre feuchten, warm dampfenden Nüstern, sie riechen daran, stupsen danach. Olga schnappt nach meiner Hand, ich erschrecke wie ein Kind, ziehe die Hand zurück und springe hinter meinen Onkel, halte mich geduckt an seinem Arm, sein krachendes Lachen wie ein winziges Gewitter, ich fühle seinen massigen Leib beben und die Kühe scheinen mit ihm zu lachen oder es wenigstens zu kennen, sie erschrecken nicht im mindesten. „Nochmal“, ruft mein Onkel und macht es mir vor, er hält Olga seine Hand hin, die sofort im Kuhmaul verschwindet, ich sehe die riesige lange Zunge darum tanzen und denke: Es ist keine Woche her, dass ich einen solchen Leib ausgeweidet habe, jetzt steht er lebend, atmend, schleckend, schmeckend, liebend vor mir, ein Wunder. Wunderschön. „Mach schon“, sagt mein Onkel und seine kuhmaulnasse Hand greift nach meiner und wie man einen Stecker in die Steckdose steckt, so steckt er meine Hand in Olgas warmes Maul, ich fühle den glatten, geriffelten Gaumen, davor die breiten harten Zähne, das Saugen und von unten die schmirgelpapierraue Zunge, kitzelnd und kratzend, warm und lebendig. „Sie mag dich“, sagt Onkel Oldenburg und stößt mich an. Ich lächele verlegen wie ein schüchternes Mädchen.
Zwischen meinen Schenkeln spüre ich die Wärme und die Bewegungen eines fremden Lebewesens. Es ist nicht schwierig mich zu halten, ebenmäßig und scheinbar ohne mich als Last zu empfinden, läuft Olga vierbeinig durch den Wald, ein sanftes Schaukeln. Ein heuartiger, warmer Duft steigt zu mir auf, kommt in Wellen, Onkel Oldenburg reitet neben mir auf Heide, Moni trottet hinterher. Es ist ein Moment, wie aus dem Kern des Lebens geschnitzt, so einfach, so ursprünglich, so verloren und vergessen, so unfassbar weit weg von allem, dass mir Tränen in die Augen steigen. Ich bin ein Naturvolkmensch, reite auf einer Kuh durch einen unberührten Wald, ich bin ein Kinderbuchheld, Karl May hat mich erfunden, Rüdiger Nehberg klettert in einem Wipfel, ich möchte mich nackt ausziehen und Bäume umarmen. Ich muss lachen.
Der Wald wird dichter, dunkler, wir traben eine leichte Steigung hinauf, in die Buchen, Weiden und Eichen mischen sich Nadelhölzer und weniger Licht fällt auf den Boden, es riecht pilziger und mein Onkel reitet auf Heide voran. Er sieht sich nach mir um:, „Gleich“, raunt er und ich muss gar nichts tun, die Kühe laufen von selbst, sie kennen den Weg, scheint mir. Da, plötzlich bricht der Wald auf, es ist, als seien wir durch brackiges Wasser geschwommen, mitten hinein in eine helle Blase aus erfrischender Luft. Wir stehen plötzlich auf einer Lichtung, mitten auf einer kleinen Anhöhe und Onkel steigt ab von seiner Kuh, legt seine Hand auf Heide, tätschelt liebevoll und dankbar ihren Rücken, seine Augen funkeln. Dann weist er mit großer Geste auf das vor uns liegende Feld. Jetzt erst erkenne ich: grün und rot leuchtend, mitten im Wald, liegt unberührt ein Feld reifer Erdbeeren. Ich steige ab und fasse es nicht. Erdbeeren. Kleine Früchte, dunkelrot.
„Hahaaa!“, macht Onkel Oldenburg und klatscht in seine Hände. „Das kann man nicht mit der Post schicken, oder?“ Wie groß ist dieses Feld? Auch wenn die Früchte klein sind, müssen hier zentnerweise Erdbeeren wachsen, wuchern, glühen. Wir fallen auf die Knie und krabbeln vorsichtig im Pflanzenmeer. Eine unfassbare fruchtige, sonnenwarme Süße, aromatisch und erdbeerig wie noch nie eine Erdbeere geschmeckt hat. „Du musst“, sagt Onkel, „eine ganze Hand voll sammeln und sie dir auf einmal in den Mund stecken, das ganze Maul voll Erdbeeren, dich dann auf den Rücken legen, dich vom Himmelblau schwindelig färben lassen und das Erdbeermus ganz langsam im Mund zergehen lassen“, sagts und haut sich die prall gefüllte Pranke in den Mund, fällt um, liegt auf dem Rücken, schnauft wie ein sattes, müdes Schwein und irgendwo aus seinem Inneren, scheint mir, steigt ein katerhaftes Schnurren. Am anderen Ende des Erdbeerfeldes grasen seelenruhig die Kühe. Meine Hand gehorcht und füttert mich.
Man muss endlich zur Besinnung kommen, denke ich. Wenn ich Vater, Bruder, Mann bin, kann ich nicht in der Stadt leben, kann nicht bis zur totalen Erschöpfung Tierkadaver präparieren, mich von kleinen, merkwürdigen Frauen hypnotisieren lassen. Ich muss mich mit Lebendem umgeben, um ein Vater sein zu können. Ich muss weg von Frauchen, weg von der Vision. Ich muss meine Schwester retten, hier hin retten, warum sollte nicht hier, ausgerechnet hier der Ort sein, an dem wir sein können? Wo alles gut ist, wo man uns lässt. Der, vor dem ich weggelaufen bin, ein alkoholkranker Misanthrop, wie sollte der Vater sein können? Wie sollte der überhaupt nur fünfzig Jahre alt werden können? Und warum sollte ich ein Weltwunder bauen, mich opfern für eine Nachwelt, die ich niemals kennen lernen werde, ich muss lachen, über mich selbst lachen und zwar nicht leise und innerlich, ich muss laut lachen, ich spucke Erdbeeren Richtung Himmel, es sprotzelt ochsenblutrot aus meinem Maul, ich liege und lache und eine Fontäne aus Erdbeermus brodelt über meinem Kopf. Onkel steigt mit ein, wir liegen und lachen und er weiß gar nicht, warum ich lache, aber es ist so lächerlich: Ich wollte ein Wunder bauen. Ein Monument. Für was? Für wen? Ich wollte den Wissenschaftlern der Zukunft ein Piktogramm liefern, etwas, das unabhängig von Schriftzeichen in seiner Symbolik universell verständlich ist. Ich wollte mich verewigen. Was ist das für eine Kategorie? Die Ewigkeit? Für einen wie mich? Einen menschlichen Wurm, Schluckauf des Universums. Ewigkeit? Unsterblichkeit? Erdbeeren!
Als wir uns beruhigt haben, strecke ich die Hand aus, lege sie auf die meines Onkels, er lässt mich, ich fühle seine Haut, fast so rau wie die Zunge der Kuh, und ich sage: „Ich habe eine Schwester.“
„Ich weiß“, sagt Onkel.
„Meine Schwester heißt Rieke“, sage ich.
„Ich weiß“, sagt Onkel.
„Rieke ist schwanger“, sage ich.
„Ich weiß“, sagt Onkel.
„Gut“, sage ich und wundere mich nur darüber, dass es mich nicht wundert, dass er alles weiß. Hier fühlt sich das richtig an. „Ich muss ihr diesen Ort zeigen. Ich muss sie hier her bringen. Hier her, in Sicherheit.“
„Unbedingt“, sagt Onkel. Und ich sehe ihn an, diesen großen, schweren, zugewucherten Mann, der mir eigentlich vollkommen fremd ist. „Und du bist also mein Onkel?“, frage ich. Und da nickt der fremde Mann, ganz sanft, wie man ein junges Kaninchen streichelt. „Der große Bruder meiner Mutter?“
„Der kleine“, sagt er und lächelt ein ganz kleines Kleinerbruderlächeln.