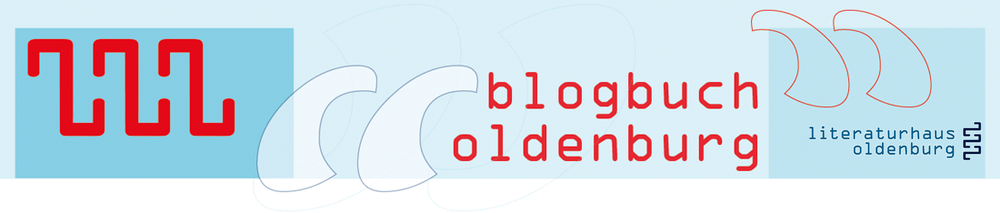Die Geschichte, die uns der einäugige Fritz erzählt, beginnt in den Siebzigern. Oder in den Achtzigern. Oder in den Neunzigern. Das weiß der einäugige Fritz nicht so genau, und auch Evie ist unsicher. Sie beginnt jedenfalls irgendwann, und sie beginnt mit den Hunden.
Es war ein Sommer, ein ganz besonders heißer Sommer, also sicher 25 Grad hier im Norden, und erst verschwand ein Hund und dann ein zweiter und dann ein dritter und so ging es immer weiter. Gut zehn Hunde müssen damals verschwunden sein, hier ganz in der Nähe vom Flötenteich. Nur kurz von der Leine gelassen und ab ins Grüne und weg waren sie.
„Ja, damals hing hier alles voller Plakate“, sagt Evie, die sich gut erinnert an diesen heißen Sommer vor zwanzig oder dreißig oder vierzig Jahren. Belohnung für Nero. Und Belohnung für Smutje. Und Belohnung für Rocko.
Aber keiner von den Hunden wurde je wiedergefunden. „Irgendwie dachten wir wohl alle, sie seien im See, wie auch immer sie da reingekommen und ertrunken sein sollten“, sagt Evie.
„Ja, und dann Ende August, da verschwand der Junge. Tobias. Zehn war der vielleicht.“
„Sieben“, sagt der einäugige Fritz.
„Nee, mindestens zehn, eher zwölf“, sagt Evie. „Das war so eine Gruppe von Jungen, fünf, glaube ich. Die machten immer alles zusammen. Im Sommer waren die jeden Tag hier draußen und gingen schwimmen. Tobias, das war der jüngste von denen. Der durfte überhaupt nur mit, weil er der Bruder von irgendwem anders war. Torbens Bruder.“
„Jens’ Bruder“, sagt der einäugige Fritz.
„Nee. Torbens Bruder“, sagt Evie.
„Die Fünf hatten sich jedenfalls in den Kopf gesetzt, dass sie ihn wiederfinden würden“, fährt Evie fort, die dicht an der ganzen Geschichte dran gewesen ist, so dicht, dass sie mir nun Dinge erzählt, die eigentlich überhaupt nur Torben oder Tobias oder Jens wissen können.
Einer der fünf, weiß Evie etwa, hatte nämlich eine Vermutung, was geschehen sei, also mit den Hunden und mit dem Jungen. Einer der fünf, sein Name war Michel, war während des Mathematikunterrichts heimgesucht worden, von einer Vision. Er hatte jemanden gesehen, jemanden, den er nie ganz genau und mit richtigen, tatsächlich, gemeinhin oft benutzten Worten hatte beschreiben können.
Eine Gestalt, eine Anwesenheit, ein Etwas, das sich herumtrieb, am Flötenteich, das lebte im Schilf.
Archiv des Autors: blogbuch
25. Die Geschichte vom Schilfmann (2)
Im Nachhinein könne niemand genau sagen, wer die Geschichte erfunden, wer sie sich erdacht hatte. War es tatsächlich Michel, der zum ersten Mal vom Schilfmann erzählte, jener Gestalt, die ihn in kurz vor der großen Pause zwischen Wurzeln und Dezimalbrüchen heimgesucht hatte? Nein, im Grunde waren sich alle Kinder einig, dass sie schon immer vom Schilfmann gewusst hatten, sich schon immer Geschichten über den Schilfmann erzählt hatten. Und auch den Eltern der Kinder war es, als seien sie selbst in den Zeiten, da sie Kinder gewesen waren, von ihren eigenen Eltern vom Schilfmann gewarnt worden.
Geht nicht zum Flötenteich, sonst fasst euch der Schilfmann!
Aber es war Michel, Michel ohne Zweifel, der vorschlug, sich auf die Jagd nach dem Schilfmann zu machen. Denn wer den Schilfmann fand, der würde auch Tobias wiederfinden, da war er sich sicher.
„Die waren so ein Trupp, wie die Fünf Freunde, nur ohne Hund“, weiß der einäugige Fritz. „Zogen um den See, trieben sich im Schilf rum.“
„Und dann?“, fragt mein Bekannter gespannt.
Aber der einäugige Fritz zuckt nur mit den Achseln.
„Na, mehr wissen wir im Grunde auch nicht. Nur, dass der Junge, also der verschwundene, dass der nie wieder aufgetaucht ist.“
„Und der Schilfmann?“, frage ich atemlos. „Was ist mit dem? Haben die Jungen ihn gefunden? War es bloß ein ganz normaler Mann? Einer, der eben zufällig im Schilf lebte? Was tat er dort? Was hatte er mit den Hunden vor, und was mit dem Jungen?“
Nun aber zuckt auch Evie mit den Achseln. „Nee, mehr wissen wir da wirklich nicht drüber. Tut uns leid.“
Mein Bekannter und ich tauschen einen ratlosen Blick. Wir stellen Evie und dem einäugigen Fritz noch ein paar Fragen, die aber nirgendwo hinführen. Gleich wie geschickt wir unsere Fragen verpacken, über den Schilfmann wissen die beiden nun einmal nichts weiter.
Die Sonne steht schon tief, als mein Bekannter und ich noch eine letzte Runde um den Flötenteich drehen. Hin und wieder meine ich, eine Bewegung aus den Augenwinkeln und im Schilf gesehen zu haben, aber immer wenn wir stehen bleiben und uns das Schilf in aller Ruhe ansehen, gibt es da nichts zu entdecken, erst recht keinen Mann.
Irgendwann gehen wir zurück zum Auto.
„Morgen fahre ich zurück“, eröffne ich meinem Bekannten und bin über meine Worte fast so überrascht wie mein Bekannter. Aber im selben Moment, da ich sie gesprochen habe, weiß ich, dass es so und nicht anders sein kann: Morgen fahre ich zurück nach Berlin. Als hätte irgendwo irgendwer eine Tür geschlossen, als sei ein Datum, auf das ich die ganze Zeit gewartet habe, plötzlich gekommen, eine Art Frist erreicht, eine Vereinbarung abgeschlossen. Meine Zeit hier ist abgelaufen. Das weiß ich, das weiß das schreiend Ding, das weiß Herman Holmer, und die Erftenmoder weiß es, und mein Bekannter weiß es auch.
„Tut mir leid“, sagt mein Bekannter.
„Was?“, frage ich.
„Na, das wir überhaupt nichts gefunden haben. Dass es jetzt auch noch so endet, hier am Flötenteich, mit irgendwelchen Andeutungen, mit irgendetwas, was anfängt, aber überhaupt nirgendwo hinführt. Der Schilfmann …“ Er schüttelt den Kopf.
„Spinnst du?“, frage ich. Ich denke an die Erzählung vom Schilfmann, die eigentlich gar keine Erzählung ist, die fünf Freunde ohne Hund, über die ich kaum etwas weiß, die den Schilfmann gefunden haben oder nicht, ich denke an den verschwundenen Jungen, der wohl nie wieder aufgetaucht ist, und all die Oldenburger Hunde, die mir im Grunde ziemlich gleich sind, ich denke an all die Fragen und an die Antworten, die uns der einäugige Fritz nicht hat geben wollen. In meinem Kopf greife ich zum Stift, in meinem Kopf fange ich bereits an zu tippen. Es war der heißeste Tage des Jahres, tippe ich.
„Was meinst du?“, fragt mein Bekannter.
„Na, ich habe doch das, weswegen ich hier gekommen bin“, sage ich.
Mein Bekannter runzelt die Stirn.
„Eine Geschichte“, sage ich. „Ich habe eine Geschichte.“
Ich verabschiede mich von meinem Bekannten, ich verabschiede mich von dem Studenten und von Siggi und Bruno, ich spreche einen stummen Dank, den ich der Erftenmoder und Herman Holmer schicke. Am späten Nachmittag setze ich mich in den Zug und fahre nach Hause.
Meine Wohnung in Berlin ist fremd und still und so verschwiegen, als hätte sie ein Geheimnis. In der Küche setze ich mich an meinen Tisch, ich mache mir nichts zu essen und keinen Tee. Ich stellte den Computer an, öffne ein Dokument. Es ist weiß und geräumig und bereit für mich.
Ich fange an.
Sabrina Janesch
 Sabrina Janesch, 1985 in Gifhorn geboren, studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim und Polonistik in Krakau. Sie erhielt bereits Stipendien des LCB und des Ledig House/New York. 2009 war sie erste Stadtschreiberin von Danzig.
Sabrina Janesch, 1985 in Gifhorn geboren, studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim und Polonistik in Krakau. Sie erhielt bereits Stipendien des LCB und des Ledig House/New York. 2009 war sie erste Stadtschreiberin von Danzig.
Für ihren ersten Roman „Katzenberge“ (2010) wurde Sabrina Janesch mit dem Mara-Cassens-Preis für das beste Debüt, dem Nicolas-Born-Förderpreis und dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet. In „Katzenberge“ macht sich eine junge Frau nach dem Tod ihres galizischen Großvaters auf die Suche nach der Geschichte ihrer Familie. Sie folgt dazu seinem Lebensweg und reist auf den Spuren seiner Herkunft tief ins östliche Polen, nach Schlesien und schließlich nach Galizien. Was sie findet, ist ein Schicksal aus Deportation und Vertreibung. Zwei Jahre später erschien der zweite Roman „Ambra“, der eine deutsch-polnische Familie portraitiert und deren individuelle Familiengeschichte in die deutsch-polnische Zeitgeschichte einbindet. Die junge Erzählerin des Buches, eine Deutsche, bekommt von ihrem polnischen Vater eine Wohnung vererbt. Das Buch wurde dafür gelobt, nicht nur ein großartiges Familienportrait zu zeichnen, sondern zudem ein atmosphärisch dichtes Portrait der Stadt Danzig. Im Juli 2014 erschien der dritte Roman von Sabrina Janesch unter dem Titel „Tango für einen Hund“. Das Land Niedersachsen gewährte ihr für die Arbeit daran ein Jahresstipendium, weil der Roman „mit der Kraft des Humors ein facettenreiches Gesellschaftsbild unserer Gegenwart entwirft“, so die Begründung der Jury.
Von Anfang an
Vor langer Zeit bezog ein Oldenburger Kaufmann notgedrungen Quartier in einem Andendorf. Noch immer erzählen sich seine Bewohner Geschichten über das sagenhafte Oldenburg, von dem ihnen monatelang berichtet wurde.
Ein Oldenburger also, und das mitten in Südamerika.
Nennen wir ihn etwa Enno Gödecke, lassen ihn um 1840 in Oldenburg geboren sein, Kaufmann, Kavalier und Abenteurer, der sich und seinen Textilhandel nach Lima, Peru verlegt.
Wenn es den Gödecke doch bloß gegeben hätte, jenen Schlawiner, Schlaumeier, jenen Galgenstrick und Schlot, aber wie sagt der Franzose – tant pis! Dann muss man ihn sich eben selber erfinden, sei’s drum
Der Pazifik, das ist etwas anderes als der Jadebusen!
Und die Anden, die sind etwas anderes als der Harz, soviel steht fest.
Señor Gödecke jedenfalls, kaum installiert und etabliert in der Stadt der Könige, vernimmt den Ruf der Berge und ihrer Schätze. Rasch kauft er ein paar Esel, ein Zelt, Küchenutensilien und eine rollbare Rosshaarmatratze. Mit einigen Eseltreibern macht er sich auf den Weg gen Sierra.
Unterwegs folgt er dem Ratschlag seiner compañeros und ersteht für seine indianischen Gastgeber in spe einen Sack voller Kokablätter.
Dann also das altiplano, das Hochplateau. Gödecke bedenkt den Südwinter nicht und kaum, dass er mit Mühe Huaquepata, ein entlegenes Indianerdorf erreicht, schneit es ein, und für den Gödecke geht es weder weiter noch zurück.
Glück für ihn, dass sich die Bewohner von Huaquepata durch einen wachen Verstand und regen Geschäftssinn auszeichnen. Wie sonst hätten sie es seit Jahrhunderten auf dem Hochplateau ausgehalten; Generation um Generation großgezogen, trotz aller Widrigkeiten und aller Unbill, die 4000 Meter über dem Meer mit sich bringen.
Jedenfalls – wie er da sitzt, besagter Gödecke in seinem gottverlassenen Andendorf und wie er merkt, dass ihm die Kokablätter ausgehen und die Freundlichkeit der Gastgeber im selben Maße abnimmt wie die Zahl der Blätter in seinem Beutel, da erinnert er sich plötzlich an eine seiner Kindheitslektüren: Scheherazade. Mit ihren Geschichten hielt sie den ungnädigen König immerhin tausendundeine Nacht lang bei Laune, und so denkt sich Gödecke: Was für einen König recht und billig ist, soll für die Dörfler von Huaquepata gerade gut genug sein.
Am Abend dann die fragenden Blicke und wieder die Hände, die sich fordernd in seine Richtung strecken.
Kokablätter, knarzt der Dorfälteste. Das ist die Tradition.
Aha, denkt sich Gödecke, jetzt, Gödecke! – und sagt dem werten Herrn, dass er heute Abend etwas Besseres als Kokablätter für ihn hätte. Heute Abend, sagt Gödecke, gebe es etwas, das viel stärker sei und den Geist in viel erheblicherem Maße beneble, umgarne und verwirre.
Heute Abend, so Gödecke, erzähle er eine Geschichte. Ob man an diesem Orte hier, Huaquepata, jemals von Oldenburg gehört habe? Irgendwer? Nein?
Nun gut.
Das Klima, also, halte man in Huaquepata für harsch und lebensfeindlich?
Im Vergleich zum Klima in Oldenburg sei das noch gar nichts.
Und man selber halte sich wohl für besonders zäh und ausdauernd?
Da habe man wohl noch keine Oldenburger kennengelernt.
Unsere Esel!, piepst da ein Kind aus dem Hintergrund. Unsere Esel sind die schlausten weit und breit!
Das glaube er gern, sagt Gödecke. In Oldenburg aber wären die Esel so schlau, dass es einer von ihnen sogar einmal bis zum Bürgermeister gebracht habe. Aber von Anfang an.
Tiefenkrankheit [ 1 ]
Aber von Anfang an. Nicht nur, dass dem Reisenden der Weg nach Oldenburg durch Marschland, Moore und Sümpfe auf ekligste Weise erschwert wird – am schlimmsten sind die Gefahren, die dem Fremden durch die besondere Tiefenlage Oldenburgs drohen.
Oldenburg liegt lediglich zwei – zwei! – Meter über dem Meeresspiegel. Was das konkret bedeutet, darüber machen sich die wenigsten Reisenden Gedanken.
Denn wer zu schnell aus höher gelegenen Gebieten anreist – und das ist immerhin fast der gesamte Rest der Welt – der darf pro Tag maximal hundert Meter absteigen, sonst drohen rasender Kopfschmerz, Atem- und Schlaflosigkeit. Das wiederum liegt an dem fast schon obszön hohen Sauerstoffgehalt der Luft in diesen Tiefen.
Wer auf erste Anzeichen der unterschätzten Tiefenkrankheit nicht achtet und entgegen aller Empfehlungen nicht in höhere Lagen aufsteigt, dem drohen im schlimmsten Falle sogenannte Tiefenlungen- und Hirnödeme.
Hat man es schließlich nach Oldenburg doch geschafft, sollte man es in den ersten Tagen ruhig angehen lassen und am besten den Eingeborenen nacheifern: Bei jeglicher Gelegenheit soviel Tee in sich hineinschütten als irgend möglich. Das gleicht den Flüssigkeitshaushalt aus und hebt ungemein die Laune.
Falls auch das nichts nützt, so haben die Oldenburger in ihrer rastlosen Fürsorge für Zugereiste einen besonderen Turm errichtet, in dem die Tiefenkranken verarztet werden. Immerhin befinden sie sich dort knapp acht Meter über dem Straßenniveau, und die peinliche Dichte der Luft nimmt nach oben hin wieder etwas ab.
Die Lappen, wie die kränklichen Ortsfremden augenzwinkernd genannt werden, werden dort rund um die Uhr gepflegt, und so heißt der Turm nach jenen, die in ihm darben: Lappan.