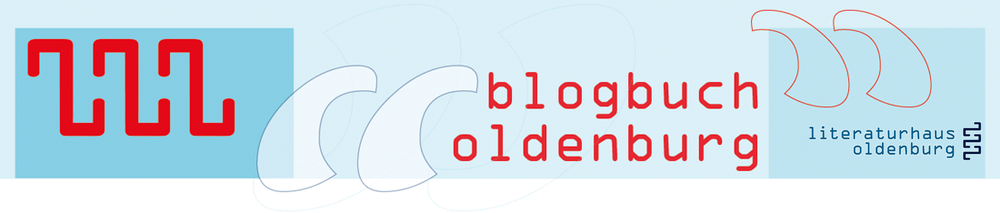Ich will mir hier nichts ausdenken, ich will es genau so erzählen, wie es sich zugetragen hat. Und wenn man ordentlich erzählen will, wie etwas gewesen ist, fängt man am besten am Anfang an.
Der Anfang ist aber recht langweilig, das will ich gar nicht verschweigen. Am Anfang bin bloß ich, wie ich an meinem Tisch in der Küche sitze und gerade gefrühstückt habe und nun sehr lange sehr still sitze und mir den Kopf zerbreche. Ich möchte etwas über Oldenburg schreiben, ich möchte es und ich soll es auch; es ist mein Auftrag. Ich weiß nicht viel über Oldenburg, außer dass Oldenburg wie ja überhaupt alle Gegenden, Dörfer, Wälder und Städte ein unheimlicher Ort sein kann. In Oldenburg selbst bin ich erst zwei Mal gewesen und beide Male ist mir nichts Verdächtiges aufgefallen, außer vielleicht, dass ich mir am Bahnhof extra starken Coffee to go kaufte, von dem ich aber überhaupt nicht wach wurde. In diesem Fall unheimliche, ja übernatürliche Kräfte zu vermuten, wäre aber vermutlich übertrieben.
Vor Ort kann ich vorerst nicht ermitteln. Das macht aber nichts, meine abenteuerlichen Erkundungen der Welt finden ja oft eher im Virtuellen statt. Es passt auch ganz gut zu dem Auftrag, den ich erhalten habe. Ich verstehe mich nun selbst als virtuelle Detektivin. Um etwas über die unheimlichen Seiten Oldenburgs herauszufinden, werde ich mich als Erstes dem den meisten Oldenburgern vermutlich bekannten Standardwerk „Aberglaube und Sagen aus dem Herzogtum Oldenburg“ von Ludwig Strackerjan widmen. Von E-Books bekomme ich immer Kopfweh, aber es muss ja schnell voran gehen mit meiner Suche, und mit wenigen Klicks habe ich 800 Seiten wertvolle Informationen auf meinen Computer gezaubert. Zaghaft und ganz virtuell beginne ich zu blättern. Nach was ich suche, weiß ich selbst nicht genau, aber auch das entspricht meinem Wesen und überhaupt meiner schriftstellerischen Arbeit. Als Autorin weiß man schließlich oft nicht, nach was man eigentlich sucht, und erkennt es bloß ganz überrascht, wenn man es gefunden hat.
In diesem Fall werde ich auf Position 398 fündig. Hier heißt es:
»Wenn ich dem Knaben sage: ›Geh nicht zu nah ans Wasser, die Nixe zieht dich nein‹ [sic!] oder die Mutter droht den Kindern: Geht nicht an die Erbsen, die ›Erftenmoder‹ oder: Geht nicht in das Roggenfeld, die ›Roggenmoder‹ faßt [sic!] euch, so ist das wiederum Aberglaube, aber wirkt er schädigend auf die Erziehung?«
(Strackerjan, Ludwig, Aberglaube und Sagen aus dem Herzogtum Oldenburg. Altmünster: Jazzybee Verlag Jürgen Beck 2012, Position 398.)
Schon als ich den Satz lese, stellen sich mir die Nackenhaare auf, und darum weiß ich, dass ich eine Spur gefunden habe. Wenn es um das Unheimliche geht, muss man immer und unbedingt auf seine Nackenhaare vertrauen. Sie sind der zuverlässigste Kompass in grauschattigen Zwischenwelten.
Was ist eine Erftenmoder?, frage ich mich mit einigem Unbehagen. Mit meinem bescheidenen linguistischen Knowhow widme ich mich einige zähe Momente dieser Frage und komme zu dem Schluss: vermutlich eine Art … Erbsenmutter. Was genau geht vor sich, wenn sie sich die Kinder faßt? Fassen erinnert wohl nicht ungefähr an „fressen“, aber warum sollte ausgerechnet die Mutter der Erbsen Kinder fressen wollen? Ein Racheakt womöglich? Kinder essen Erbsen ja aber eher ungern. Ein Freund von Erbsen bin auch ich selbst nie gewesen, aber richtig unheimlich sind sie mir nicht. Schnell zeichnet sich ab: Durch freies Assoziieren komme ich hier nicht weiter. Ich muss mehr über die Erftenmoder herausfinden. Hierzu gehe ich vor, wie ich es immer tue, wenn ich gewissenhaft an einem neuen Projekt arbeite und etwas in Angriff nehmen muss: Ich mache mir zunächst einen Kaffee. Ich trinke meinen Kaffee, ich gehe schnell eine Runde spazieren, weil ich so aufgedreht vom Kaffee bin, ich gehe noch zu Edeka, um neuen Kaffee und Magentee zu kaufen, ich setze mich an den Schreibtisch, google das Wetter der nächsten Wochen, schaue mir die neusten Trailer der neusten Horrorfilme an, google was der Schauspieler Daniel Day Lewis in den letzten Jahren gemacht hat, mache mir neuen Kaffee. Nun, da ich das umständliche Programm der mentalen Vorbereitung durchlaufen habe, setze ich mich wieder an meinen Schreibtisch, betrachtete die Tastatur meines Computers und entdecke Krümel und kleine, merkwürdige Flecken. Nachdem ich diese eine Weile mit einem Q-Tip gereinigt habe, bin ich hungrig von der getanen Arbeit des Vormittags und koche mir Nudeln.
Am späten Nachmittag schließlich beginne ich mit meiner Recherche und google „Erftenmoder“.
Gleich drei Ergebnisse!
Vor Erleichterung ganz aufgedreht beschließe ich, erst einmal eine kleine Pause auf dem Balkon zu machen und ein Eis zu essen. Die Ernüchterung folgt bei meiner Rückkehr: Hinter allen drei Ergebnissen verbirgt sich Strackerjan. Mit meinen investigativen Fähigkeiten vorläufig am Ende schaue ich mir Horrorfilmtrailer an, die ich mir schon am Vormittag angesehen habe, wegen ihrer Musik und schnellen Schnitte aber besonders mitreißend fand. Danach schreibe ich meinem Bekannten in Oldenburg eine Email. Mein Bekannter ist mein Experte vor Ort. Sein Expertentum begründet sich vor allem in der Tatsache, dass er vor Ort ist, was ich ja bekanntermaßen nicht bin. Ob er schon einmal von der Erftenmoder gehört habe, ob sie ihm womöglich begegnet sei, frage ich und erkundige mich auch noch nach Freundin, Karriere und Hund, damit ich mir nicht vorwerfen lassen muss, es ginge mir nur um die Erbsen. Kurz darauf erhalte ich die ernüchternde Antwort: Nein, nie von der Erftenmoder gehört. Nein, begegnet ist er ihr auch nie. (Karriere: okay, Freundin: vorbei, Hund: Gastritis.)
Ich schaue aus dem Fenster und meinem Basilikum beim Sterben zu und bin enttäuscht. Sollte mich meine Suche so früh schon in eine Sackgasse geführt haben? Mein extra starker Mittagskaffee hat mich schon wieder müde gemacht, also schließe ich die Augen, döse vor mich hin und denke über die Erftenmoder nach. Ich stelle sie mir irgendwie viktorianisch vor, in einem schwarzen Kleid also, das immer raschelt, wenn sie sich bewegt. Ich denke, dass sie sehr schmal ist, ja hager, ja ausgemergelt. Sie hat knochige Hände und ein knochiges Gesicht und wirkt alt und gleichzeitig überhaupt nicht alt. Wenn man ihr Gesicht sieht, hält man es für möglich, dass sie über hundert Jahre ist, aber sie bewegt sich überraschend schnell und lautlos; das muss sie auch, wie sollte sie sonst die Kinder fassen können? Ihre Haut ist sehr weiß und hat einen leicht grünlichen Schimmer. Deswegen, überlege ich, nennt man sie Erftenmoder.
Ich habe die Augen geschlossen, denke an die grünlich weiße Haut der Erftenmoder und schaukle gerade auf meinem Stuhl vor und zurück, als es plötzlich an der Wohnungstür klopft. Vor Schreck falle ich fast vom Stuhl. Bestimmt nur der Paketbote oder vielleicht die Nachbarin, denke ich, aber im Grunde glaube ich selbst nicht daran. Etwas an dem Klopfen selbst, der bestimmte schnelle Takt womöglich, eine gewisse Dringlichkeit oder Bestimmtheit, schließen jeden Paketboten und Nachbarn aus. Das sonderbarste Gefühl kommt mir, während ich aufstehe und durch die Küche und weiter in den Flur schleiche. Einen Moment stehe ich ganz still und betrachtete die Wohnungstür, hinter der sich verbirgt, wer immer da an meine Tür geklopft hat.
Meine Nackenhaare stellen sich auf.