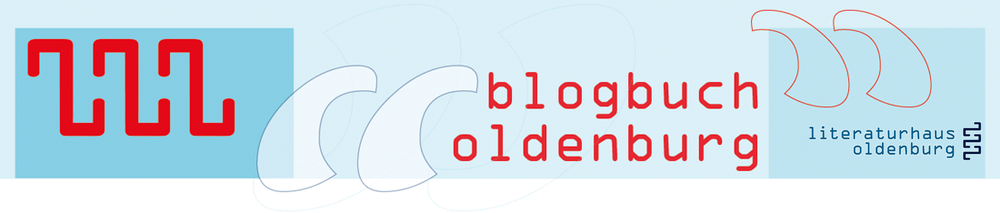Natürlich würde man gerne die Geschichte des ersten Oldenburger Stadtschreibers unter den Tisch kehren – aber wie das meiste, was man gerne unter den Tisch kehren würde, hat sich auch diese Geschichte verselbstständigt und im gesamten Umland die Runde gemacht.
Vor vielen Jahren war in den großen Städten der Region die Mode aufgekommen, sich einen Stadtschreiber zu halten. Meist waren dies verschreckte, bucklige Schreiberlein, die in einem Turmzimmer oder einer Kellerwohnung saßen und für einen Hungerlohn Tag und Nacht alles verzeichneten, was in der Stadt geschah.
Hannover hatte einen Stadtschreiber, Bremen hatte einen Stadtschreiber; und als man munkelte, Hamburg habe sogar drei Stadtschreiber, da war es dem großen Häuptling Anton genug und er beauftragte einen seiner Beamten damit, einen Stadtschreiber auch für Oldenburg zu finden.
Trotz Turmzimmerchen, trotz bestem Hungerlohn und jeder Menge Material, das verarbeitet werden wollte, fand sich wochen-, gar monatelang kein buckliges Schreiberlein, dass sich in Oldenburg niederlassen wollte.
Der große Häuptling Anton fasste sich ein Herz, setzte sich in seine Kutsche und fuhr nach Hamburg, von wo er wenige Tage später zusammen mit einem unförmigen Sack wieder zurückkam. Er ließ es sich nicht nehmen, den Sack höchstpersönlich hoch ins Turmzimmerchen zu schleppen. Oben angekommen schüttelte er ihn noch ein wenig, langte hinein und beförderte schließlich das prächtigste bucklige Schreiberlein zutage, das die Stadt jemals gesehen hatte.
Jetzt also Oldenburg, sagte der große Häuptling Anton noch, bevor er dem Männlein auf die Schulter klopfte, ihm eine Feder in die Hand drückte und das Turmzimmer verließ.