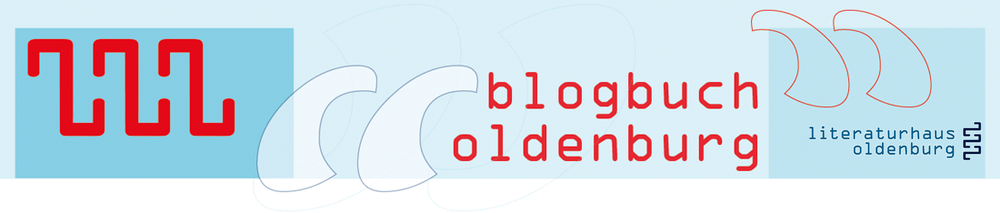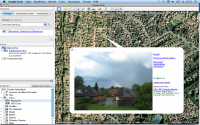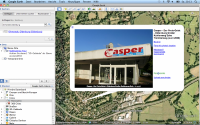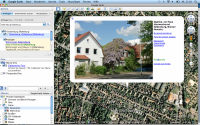geschrieben am 15.11.2011
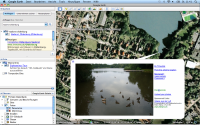 Was ist denn los, Oldenburg? So still ist es um dich geworden in letzter Zeit. Ist das schon der Winter? Sitzen schon alle zu Hause in kuscheligen Wollpullovern, die Hände an die Teetasse geschmiegt, die Gedanken schon beim Weihnachtsbummel? In die Schlagzeilen schafft man es jedenfalls dieser Tage schon, wenn man auf originelle Weise ausparkt oder sich ein paar Hundert Euro unter den Nagel reißt. Selbst die Bilder auf Google Earth werden spärlicher. In Nadorst muss ich mit Enten Vorlieb nehmen. Enten. Enten, die sofort aufhören, sich für mich zu interessieren, als sie feststellen, dass ich kein Brot dabei habe. „Brot ist nicht gut für eure Mägen“, erkläre ich ihnen. „Brot lagert sich im See ab und verändert das gesamte Ökosystem, das kann nicht in eurem Sinne sein“, erkläre ich, und die Enten erklären mir, dass sie an Nachhaltigkeit nicht so interessiert seien, an Brot seien sie interessiert, aber da seien sie bei mir wohl an der falschen Adresse. Ob ihnen denn nicht auch langweilig sei, frage ich. Ob sie denn nicht etwas vermissen würden, irgendetwas Großes, Rauschendes. Die Enten schauen mich skeptisch an. Nö, sagen sie. Was Großes sei ja meistens ein Raubvogel, und was Rauschendes meistens ein Wasserfall, auf beides könnten sie ruhig verzichten. Und ob ich sie jetzt bitte entschuldigen würde, sie müssten noch ein wenig herumschwimmen und quaken. Ich schaue ihnen nach, wie sie auf dem Flötenteich ihre Bahnen ziehen und wäre gerne neidisch auf sie, aber ich bin es nicht.
Was ist denn los, Oldenburg? So still ist es um dich geworden in letzter Zeit. Ist das schon der Winter? Sitzen schon alle zu Hause in kuscheligen Wollpullovern, die Hände an die Teetasse geschmiegt, die Gedanken schon beim Weihnachtsbummel? In die Schlagzeilen schafft man es jedenfalls dieser Tage schon, wenn man auf originelle Weise ausparkt oder sich ein paar Hundert Euro unter den Nagel reißt. Selbst die Bilder auf Google Earth werden spärlicher. In Nadorst muss ich mit Enten Vorlieb nehmen. Enten. Enten, die sofort aufhören, sich für mich zu interessieren, als sie feststellen, dass ich kein Brot dabei habe. „Brot ist nicht gut für eure Mägen“, erkläre ich ihnen. „Brot lagert sich im See ab und verändert das gesamte Ökosystem, das kann nicht in eurem Sinne sein“, erkläre ich, und die Enten erklären mir, dass sie an Nachhaltigkeit nicht so interessiert seien, an Brot seien sie interessiert, aber da seien sie bei mir wohl an der falschen Adresse. Ob ihnen denn nicht auch langweilig sei, frage ich. Ob sie denn nicht etwas vermissen würden, irgendetwas Großes, Rauschendes. Die Enten schauen mich skeptisch an. Nö, sagen sie. Was Großes sei ja meistens ein Raubvogel, und was Rauschendes meistens ein Wasserfall, auf beides könnten sie ruhig verzichten. Und ob ich sie jetzt bitte entschuldigen würde, sie müssten noch ein wenig herumschwimmen und quaken. Ich schaue ihnen nach, wie sie auf dem Flötenteich ihre Bahnen ziehen und wäre gerne neidisch auf sie, aber ich bin es nicht.