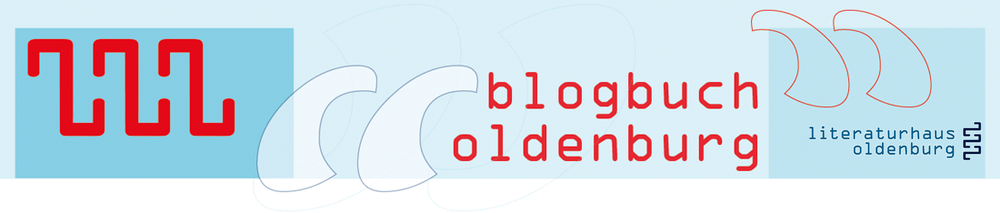Bis wir unseren Rooibos-Tee getrunken haben, ist es schon dunkel, und weil wir es mit der Gefährlichkeit nicht gleich übertreiben wollen, verschieben wir unseren Ausflug in die Haarenniederungen auf den nächsten Tag.
Als ich abends in meine Unterkunft zurückkehre, erzählt Siggi mir, dass eine sehr nette Frau da gewesen sei und mit mir habe sprechen wollen.
„Eine sehr nette Frau?“, frage ich.
„Vielleicht Ihre Mutter?“, mutmaßt Siggi.
Sie hätten zusammen Ostfriesentee getrunken und sich über mich unterhalten. Die nette Frau sei sehr besorgt gewesen um mich, habe sich erkundigt, was ich so triebe, ob ich viel unterwegs sei und die Geschichte Oldenburgs angemessen studierte.
Meiner Mutter ist eigentlich egal, ob ich viel unterwegs bin und die Geschichte Oldenburgs angemessen studiere. Die einzige Anforderung, die sie an mich und meine Lebensgestaltung stellt, ist, dass ich nicht den ganzen Tag herumliege und Gummibärchen esse. Des Weiteren würde es mich überraschen, meine Mutter in Oldenburg anzutreffen. Auch wenn sie mir einmal, das ist nun schon ein wenig her, nach Stockstadt am Rhein nachgereist ist – aber nur, weil ich sie darum gebeten hatte und aus einer berufsbedingten Notsituation befreit werden musste.
„Wie sah sie denn aus, meine Mutter?“, frage ich Siggi.
„Gute Figur“, sagt Siggi. „Ein wenig blass vielleicht?“
„Trug sie ein irgendwie viktorianisch anmutendes Kleid und hatte erbsengrüne Augen?“, frage ich.
„Ja, ganz genau!“, sagt Siggi. Und dann eröffnet sie mir noch, dass die Frau, die vermeintlich meine Mutter, in Wahrheit aber bloß die Erftenmoder, gewesen ist, etwas für mich dagelassen habe. Ein Buch.
Siggi überreicht mir das Buch, aus dem ein orangefarbener Post-It hervorschaut. Die Erftenmoder will nun anscheinend sichergehen, dass ich meine Sache ordentlich mache, und hilft ein wenig nach.
Ich erzähle Siggi von meinem Besuch bei dem Studenten, der anonym bleiben möchte. Über die unheimlichen Vorgänge in den Haarenniederungen schweige ich mich aus, aber ich berichte von dem guten Rooibos-Tee und dem Seerosen-Raumduft.
„Na so was, da könnten sie doch mal eine Geschichte drüber schreiben!“, sagt Siggi.
„Über einen Studenten, der Rooibos-Tee trinkt?“, frage ich.
„Ja!“, sagt Siggi.
„Oder vielleicht gleich lieber einen Roman“, sage ich.
„Na, mir würde dazu kein Roman einfallen. Aber ich bin ja auch keine Schriftstellerin“, sagt Siggi, und dann lächeln wir beide.
In meinem Zimmer mache ich mir erst einmal eine Tüte Gummibärchen auf und besehe mir das Buch, das die Erftenmoder für mich abgegeben hat, genauer. Es ist randvoll mit unheimlichen regionalen Geschichten. Ich schlage die Seite auf, die mir die Erftenmoder bereits mit einem orangefarbenen Post-It markiert hat. Damit keinerlei Missverständnisse möglich sind, hat sie hinter die entscheidende Geschichte auch gleich einen grünen Punkt gesetzt.
Ich fange an zu lesen.