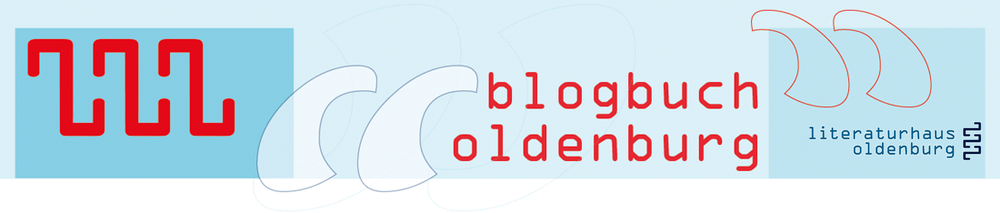Mein Bekannter und ich sitzen im Schatten der Getrudenlinde. Es ist furchtbar heiß und furchtbar hell, und ich blinzle die ganze Zeit. Dass man auf einem Friedhof auch schwitzen kann, finde ich irgendwie unangemessen. Auf Friedhöfen sollte man sich immer nur fröstelnd und durch dicke Nebelschwaden fortbewegen. Es sollte schneien oder zumindest regnen, wenn man über einen Friedhof schleicht. An diesem Nachmittag aber sind es 37 Grad im Schatten, und uns beiden ist sehr heiß.
Während wir uns diskret Schweiß von den Nasen tupfen, erzählt mir mein Bekannter die Geschichte der Gertrudenlinde. Vor vielen, vielen Jahren, erzählt mein Bekannter, wurde ein Waisenmädchen zu Unrecht des Diebstahls beschuldigt. Bei ihrer Hinrichtung steckte sie einen Zweig in den Boden und erklärte, dass sie unschuldig sei und ihre Unschuld bewiesen werde, wenn aus dem Zweig ein Baum erwachse. Sie wurde zwar hingerichtet, aber zumindest ihre Unschuld konnte dank der Linde, unter der wir jetzt sitzen, noch bewiesen werden. Ich denke darüber nach, ob das arme Waisenmädchen vielleicht auch eine Dichterin war und über das Gespräch der Tiere und ganz besonders der Bäume Bescheid wusste. Ich denke darüber nach, ob das dichtende Waisenmädchen vielleicht ein wenig zu außerhäusig gelebt hat und deswegen am Ende doch ihre ahnungslosen Arbeitgeber bestehlen musste.
Davon aber will mein Bekannter nichts wissen.
„Nein, nein, sie war unschuldig“, behauptet er, so als hätte ich seine Ehre verletzt und nicht die des dichtenden Waisenmädchens.
„Mir ist so was Ähnliches auch mal passiert“, sage ich.
Mein Bekannter schaut mich verwundert an. „Wie?“, fragt er. „Was?“
„Na, letztes Jahr, da hatte irgendwer bei uns im Treppenhaus eine Bierflasche fallen lassen. Im zweiten Stock, also genau vor unserer Wohnungstür. Und meine Nachbarin dachte, ich sei es gewesen. Aber ich war es nicht.“
„Aha“, sagt mein Bekannter unsicher. „Und dann?“
„Na, ich habe meine Unschuld versichert. Also beteuert, dass ich es nicht war“, sage ich, und meine Stimme wird ein wenig brüchig, und ich fühle mich wie ein dichtendes Waisenmädchen. „Mir hat keiner geglaubt, und ich habe die Scherben trotzdem wegfegen müssen. Obwohl ich unschuldig war.“
„Na, das ist jetzt aber nicht ganz das Gleiche“, sagt mein Bekannter.
„Habe ich ja auch nicht behauptet, dass es das Gleiche ist“, schnappe ich. „Ich habe gesagt, dass mir etwas Ähnliches passiert ist.“
Wir schweigen. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Was, wenn mir hier in Oldenburg überhaupt nichts Unheimliches mehr passiert? Was, wenn das Unheimliche bereits passiert ist, und ich es schlicht nicht bemerkt habe? Außerdem ist mir natürlich klar, dass mein Bekannter recht hat. Meine Geschichte ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem tragischen Schicksal des unschuldigen Waisenmädchens. Die Zeit der Abenteuer ist vorbei. Wie soll man heute noch Schriftstellerin sein? Von welchen fantastischen, unglaublichen, tragischen, mitreißenden, außergewöhnlichen Begebenheiten soll man erzählen, wenn einem nichts Aufregenderes im Leben passiert, als dass man die Scherben einer Bierflasche, die man gar nicht selbst zerbrochen hat, zusammenfegen muss?